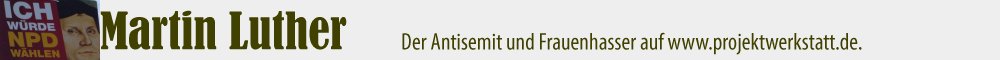DIE DEMOKRATIE ÜBERWINDEN, BEVOR SIE SICH SELBST ABSCHAFFT - ZUM SCHLIMMEREN!
Kap. 2: Demokratischer Alltag
Die Demokratie überwinden ... ● Kap. 0: Intro, Fragestellung ● Kap. 1: Massen-demokratisch ● Kap. 2: Demokratischer Alltag ● Kap. 3: Retten und scheitern ● Kap. 4: Aufbruch ● Quellen (mit aktiven Links) ● Über den Autor ● Presse und Rezensionen ● Texte mit ähnliche Positionen
Dritter Teil der Zusammenfassung des Buches „Die Demokratie überwinden, bevor sie sich selbst abschafft – zum Schlimmeren!“ von Jörg Bergstedt (SeitenHieb-Verlag) - mit ausgewählte Zitaten aus dem Teil 2 "Demokratischer Alltag" des Buches. Der Text und die Zitate dürften frei verwendet werden - um Quellenangabe wird gebeten.
Zusammenfassung des Teils 2: Demokratischer Alltag
Aus der Projektwerkstatt ++ auf UntergrundBlättle am 26.7.2025 ++ gesamtes Buch als PDFDie Grundfehler der Demokratie, unter anderem die Bildung des „demos“ als konturlose Einheit der Vielen, die Schaffung klarer Grenzen und die Anfälligkeit gegenüber populistischen Impulsen, sind keine Theorie, sondern fast überall längst eine Praxis, die nicht mehr viel mit den Idealen zu tun hat, die von der demokratischen Propaganda behauptet werden. Der Rousseausche Gemeinwille entpuppt sich schnell als Diskurs im Foucaultschen Sinne, und damit als die vor allem aus den Funktions- und Deutungseliten kraft ihrer Ämter, Reichweite, ihres Reichtums und weiterer Privilegien geformte öffentliche Meinung. Wahlen und Abstimmungen verstärken entgegen des Slogans „one man, one vote“ diese Unterschiede, denn diejenigen, die ohnehin schon bevorteilt sind, haben deutlich bessere Chancen, auf Parteilisten aufgestellt oder direkt gewählt zu werden. Dann verbinden sich ihre bisherigen Privilegien mit zusätzlicher, demokratisch erschaffener Handlungsgewalt. Das Ergebnis ist eine lupenreine Aristokratie, gut erkennbar an der Dominanz nur weniger Berufsgruppen und sozialer Schichten in Parteispitzen, Bundestag und Landtagen.
Diese Kluft zwischen Privilegierten und allen anderen wächst, denn Herrschaft ist kein neutrales, sondern ein sich selbst verstärkendes Prinzip. Wer Privilegien hat, setzt diese aus pragmatischen Gründen auch ein. Es ist schlicht funktional, Geld, Waffen, Macht oder Recht einzusetzen, wenn es verfügbar ist. Das Erleben, dass ihr Einsatz Vorteile bringt, weckt den Drang, die Privilegien zumindest abzusichern, am besten aber noch auszubauen. Allein die Absicherung stellt eine Zunahme von Herrschaft dar, weil sie zusätzliche Formen von Überwachung, Kontrolle und Sanktionierung erfordert – ein ständiges Schubsen in Richtung autoritärer Welten.
Demokratie und Kapitalismus
Das steigert sich im Kapitalismus. Dieses Wirtschaftssystem, welches Produktion und Absatz allein dem Diktat des Profitmachens unterwirft, ist bestens mit der Demokratie vereinbar – deutlich besser als mit Diktaturen oder Monarchien. Denn in letzteren hängen alle Vorteile am seidenen Faden des Wohlwollens der Ein-Mensch-Führung. Wer in Ungnade fällt, ist schnell seiner Privilegien beraubt oder gleich einen Kopf kürzer. Gegen das ständige Zittern vor einen Sinneswandels oder der Auswechselung der herrschenden Person hilft kein gut gefülltes Konto. Anders in der Demokratie: Da die Ausführenden der Macht durch die öffentliche Meinung und Lobbyismus wirkungsvoll in ihrem Verhalten beeinflusst werden können, sitzen die Privilegierten viel fester im Sattel. Um die Eliten zu entmachten, bräuchte es eine starke Zentralmacht – und die fehlt in Demokratie. Wahlen, öffentliche Meinungen, Gesetzestexte und Medienberichte lassen sich mit Geld und guten Beziehungen besser beeinflussen als an eigenen Interessen orientierte Diktator*innen.
Selbstverstärkung von Herrschaft
Die genannten Prozesse verstärken sich gegenseitig. Der Abstand zwischen Arm und Reich, zwischen Verschuldeten und Besitzenden wächst, ebenso der zwischen Menschen mit viel Reichweite und den stimmlosen Massen, zwischen Menschen an den Hebeln der Macht und den vielen Ohnmächtigen, die mit den Wahlen im Brot-und-Spiele-Stil bei der Stange gehalten werden. Am Ende wird – mal wieder – der Übergang in autoritäre Systeme stehen. Dabei müsste, mit Blick auf die Vergangenheit, gerade in Deutschland längst die Erkenntnis gereift sein, dass Demokratien mit ihren Wahlen, der Vermassung der einzelnen Menschen zum Volk und den vielen Bühnen für Populismus und Verführung immer wieder in die Diktatur führen. Ist 1933 schon vergessen? „Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie“, warnte Theodor W. Adorno.
Warum sind dennoch so viele Menschen blind gegenüber der Gefährdung der Demokratie durch sich selbst und die derzeitige Politik? Hat es die Propaganda geschafft, den offensichtlichen Zusammenhang mit der Demokratie erfolgreich aus der Erinnerung an das dunkelste Kapitel des Landes zu löschen, obwohl es die Etappen des Wandels der Demokratie zum Faschismus zwischen 1930 und 1933 schon damals keine Überraschung waren. Im historischen Athen und Rom, erstere die behauptete Geburtsstunde der Demokratie, zweitere des Rechtsstaates, verschwanden die kleinen Anfänge in Populismus, Kriegen und Einzelherrschaft. Die französische Revolution führte in die Alleinherrschaft Napoleons. Auch nach dem demokratisch herbeigeführten Desaster des Dritten Reiches reihen sich die Beispiele aneinander, in neuester mit dem arabischen Frühling, dem nach begrenzten Lockerungsübungen fast überall Diktaturen folgten. Die Anzeichen, dass auch Deutschland auf dem Weg von der Demokratie über ihre eigene Zuspitzung in autoritäre Welten schon weit fortgeschritten ist, gibt es zuhauf. Zahlen zeigen, dass sich immer mehr Menschen eine Diktatur (Stgeigerung von 2,2 % auf 6,6% und zusätzlich 23,3% statt zuvor 15,5 % der ‚teils/teils‘-Haltungen). Ebenfalls erhöhte sich der Anteil rechtsextremer Weltsichten auf 12,3 % selbst der unter 35-Jährigen. Die Totenglocken läuten längst.
Dieser Text ist die Zusammenfassung des Kapitels „Demokratischer Alltag“ im aktuellen Buch „Die Demokratie überwinden, bevor sie sich selbst abschafft – zum Schlimmeren!“ von Jörg Bergstedt (SeitenHieb-Verlag, 2025). Die weiteren Kapitel des Buches bieten umfangreiche Ausführungen und Belege, warum Demokratien an sich selbst scheitert, warum sie menschlichkeitszerfressenden Wirtschaftssystemen wie dem Kapitalismus und populistischen Strategien eine so gute Plattform bietet und auf welche Weise eine klare Analyse ebenso verhindert wird wie der Ausbruch aus dem demokratischen Teufelskreis.
- Gliederung und Infos zum Buch: demokratie-ueberwinden.siehe.website
- Erklärung zur is-Sprache: is-sprache.siehe.website
Auszüge aus dem Kapitel 2 des Buches (Demokratischer Alltag)
Kapitel zu Diskursen (S. 105)
In Diktaturen dominiert eine Person, in Oligarchien stehen Wenige an den Hebeln der Macht. In der Demokratie „herrschen“ vor allem die Diskurse und das, was aus ihnen entsteht. Wer dort die wichtigen Posten einnimmt, temporär in der Politik, dauerhaft in Wirtschaft, Medien usw., wirkt vor allem durch den größeren Einfluss auf die Denkkulturen als andere. „Der Aktivbürger unmittelbar wird angesprochen. Er soll in seinen künftigen politischen Entschließungen durch die Argumente, die er im Parlament hört, beeinflußt werden.“
Gleichzeitig bleiben auch die Mächtigen getrieben von den Diskursen, die folglich mehr prägen als die Entscheidungsmacht Einzelner. Die gesamte Gesellschaft und damit auch der „demos“ der Demokratie tanzen im Takt der Diskurse. Jeder Blick in die Geschichte oder in aktuelle Sphären der Gesellschaft bestätigt das. So gab es Jahre, in denen sich Jugendkulturen gegen Erwachsene richteten. Es gab Phasen im Feminismus, die Zuordnung zu festen Geschlechtern zu überwinden. Es gab Zeiten mit starker Kritik am Prinzip der Erwerbsarbeit. Es war der Zeitgeist, einfach „hipp“, auf Selbstverwaltung zu setzen oder als „glücklicher Arbeitsloser“ aufzutreten. Wird eine solche Strömung dominant, machen das gefühlt alle, tatsächlich aber vor allem all diejenigen, die öffentlich agieren. Sie erzeugen den dominanten Eindruck, dass es „alle“ sind. „Die“ Bewegung. „Das“ Volk. „Die“ Jugend. „Die“ …
Doch die Diskurse verändern sich. So ließen sich viele FridaysForFuture-Aktive von Erwachsenen ihre Inhalte diktieren („Hört auf die Wissenschaft!“), Pronomenrunden wurden zum neuen Standard und ein neuer Arbeitsfetischismus entstand. Auch solche neuen Diskurse spiegeln, wie die vorherigen, nicht die mehrheitliche, sondern die dominante Denkkultur. Umfrageergebnisse werden von dieser beeinflusst – und beeinflussen sie umgekehrt auch. Zwar sind Diskurse eben nicht automatisch auch die Meinung der Mehrheit, aber viele Menschen werden statt einer eigenen Meinung die auf sie einwirkenden Diskurse benennen. „Common sense ist Ideologie, die sich weigert, ihre eigene Ideologie zu sehen, ein Zoo, der aufrichtig glaubt, unberührte Natur zu sein.“
Kapitel zu Aristokratie (S. 108ff)
Um Ämter, die durch Wahl besetzt werden, entsteht in der Regel ein Konkurrenzkampf. Die Chancen, gewählt zu werden, sind bei den Bewerbis aber entsprechend ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten sehr unterschiedlich. Die gesellschaftliche Stellung, geprägt durch Gender, Herkunft und Alter, Bildungsgrad und Titel, körperlichen Einschränkungen und Biographie beeinflusst die Reichweite und die Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Die jeweiligen materiellen Möglichkeiten entscheiden über Zeit- und Werberessourcen, die für die Eigenwerbung eingesetzt werden können. Wer reich ist, folglich Zeit und Geld einsetzen kann, in der Folge zudem über gute Kontakte verfügt und dem Sympathiebild einer Gesellschaft entspricht, hat die besten Chancen, gewählt zu werden. „Laut Gesetz sind alle Menschen mit Staatsbürgerschaft politisch ‚gleich‘. In der Realität ist ihr Zugang zur politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung allerdings sehr unterschiedlich. Ressourcenstarke Bürger*innen sind in der Regel stärker involviert und können Politiker*innen leichter beeinflussen.“ …
Alle Parlamente demokratischer Staaten weisen ähnliche Ungleichverteilungen der Bevölkerungsgruppen nach Alter, Geschlecht, Berufszugehörigkeit usw. auf. Das fällt oft sehr extrem aus, zum Beispiel „dass in den beiden Kammern des italienischen Parlaments lediglich 2 (zwei) Industriearbeiter sitzen (und damit 31 Prozent aller Arbeitskräfte vertreten), aber 122 Advokaten, 55 Journalisten, 51 Ärzte, 14 Steuerberater und so weiter.“ Bei den Wählenden sieht es nicht so viel anders aus. Die Wahlbeteiligung der Bessergestellten ist deutlich höher. Im Ergebnis wählen vor allem Privilegierte aus der von stärker Privilegierten ausgewählten Schar besonders stark Privilegierter die Runde derer, die dann an die Hebel der funktionalen Macht rücken.
Kapitel zur Selbstverstärkung von Herrschaft (S. 123)
Demokratie ist eine Form der Herrschaft. Somit gilt auch für sie, was für alle Formen der Herrschaft gilt: Sie verstärkt sich aus eigener Logik heraus. Der Grund ist einfach. Machtmittel, die vorhanden sind, zu nutzen, ist funktional. Wer Privilegien oder eine Waffe hat, das Gesetz oder die Polizei hinter sich weiß, muss nicht auf Augenhöhe verhandeln. Ob bei der Verteilung von Ressourcen oder dem Einfluss auf Diskurse, herausgehobene Handlungsmöglichkeiten verleiten dazu, sie zu nutzen. Es ist einfach effizient. Aus dem Erleben dieser Effizienz folgt der Wille, diesen Vorsprung abzusichern oder zu vergrößern.
Kapitel zur Demokratie, die sich selbst überwindet (S. 140)
Der Hinweis auf die Vergangenheit müsste gerade in Deutschland zu der Erkenntnis führen, dass die Demokratie mit ihren Wahlen, der Vermassung der einzelnen Menschen zum Volk und den vielen Bühnen für Populismus und Verführung schnell in die Diktatur führen kann. Ist 1933 schon vergessen? Zumindest erwächst aus dem mehrfachen Ende der Demokratie in Richtung sich zuspitzender Herrschaft und nicht selten des Faschismus wenig Lerneffekt. „Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie.“
Warum sind so viele Menschen blind gegenüber der Gefährdung der Demokratie durch die derzeitige Politik und den Weg, den unsere Gesellschaft eingeschlagen hat, obwohl wir doch nur zurückblicken müssen, um zu erkennen, dass wir dabei sind, einige der dunkelsten Abschnitte unserer Geschichte zu wiederholen? Oder hat es die Propaganda geschafft, den offensichtlichen Zusammenhang mit der Demokratie erfolgreich aus der Erinnerung an dieses dunkelste Kapitel zu löschen?
Dabei waren die Etappen des Wandels der Demokratie zum Faschismus zwischen 1930 und 1933 kein Einzelfall. Im historischen Athen und Rom, erstere die behauptete Geburtsstunde der Demokratie, zweitere des Rechtsstaates, verschwanden die kleinen Anfänge in Populismus bzw. einem kriegslüsternen Kaiserreich. Die französische Revolution führte in die Alleinherrschaft Napoleons. Dem arabischen Frühling folgten nach begrenzten Lockerungsübungen fast überall Diktaturen. Waren diese den kapitalistisch-westlichen Staaten zugeneigt, wurden sie von denen freudig akzeptiert. Autoritäre Regimes folgen auf Demokratien, manche durch Putsch oder Eroberungskrieg, andere durch Wahlen. Von Regierungen anderer Staaten und Unternehmen, denen der Wandel nützt, kommt Beifall. Moral und Ideale gelten meist nur in Wahlkampfzeiten.
Die Anzeichen, dass Deutschland auf dem Weg von der Demokratie über ihre eigene Zuspitzung in autoritäre Welten schon weit fortgeschritten ist, gibt es zuhauf. So stieg die „Zunahme der Befürwortung von ‚Diktatur‘ von 2,2 % auf 6,6% und zusätzlich 23,3% statt zuvor 15,5 % der ‚teils/teils‘-Haltungen.“ Ebenfalls erhöhte sich „der Anteil solcher als rechtsextrem eingeordneter Weltsichten von nur 4,4% der ab 65-Jährigen bis auf 12,3 % der unter 35-Jährigen“.
Ergänzende Zitate
Zu den Themen passende Zitate - nach Veröffentlichung des Buches hinzugefügt:Türkei im Übergang von Demokratie zur Diktatur
Aus Rob Kenius (2017): "Neustart mit direkter digitaler Demokratie" (S. 16)
Dieser Prozess, wie aus einer Demokratie eine Diktatur wird, scheint sich jetzt in der Türkei, hundert Jahre später, noch einmal zu wiederholen. Erst Reden im demagogischen Stil vor riesigen Versammlungen, dann Beeinflussung der Wahlen durch die staatlichen Medien, dann Ausschalten der Opposition, Kontrolle der Justiz, Verhaftung von Oppositionellen.
Parlamentarismus (Rob Kenius, S. 44)
Schon unmittelbar nach der Wahl verfahren die Parteien mit dem Mandat willkürlich. Sie bilden Fraktionen und treten in Koalitionsverhandlungen ein. Damit beginnt ein Mechanismus, auf den die Wähler nicht den geringsten Einfluss haben. Es geschieht genau das, was die Parteiführung will. Auch die von uns direkt gewählten Kandidatinnen und Kandidaten im Parlament haben auf diese Verhandlungen keinen Einfluss, sie müssen sich an die Fraktionsdisziplin halten, sonst haben sie null Chance, noch einmal aufgestellt zu werden. Nach der Wahl operieren die Parteiführer Jahre lang völlig losgelöst; sie verteilen die politischen Posten und die Gelder, bringen Gesetze ins Parlament, bestimmen das Abstimmungsverhalten der Fraktionen und regieren so ziemlich im luftleeren Raum und zeigen sich täglich in den Medien.
Wahlen (Rob Kenius, S. 46f)
Durch das Parteiengesetz haben sich die Parteien mit ausreichend Geldern für den Wahlkampf versorgt. Dafür werden Werbeagenturen eingeschaltet, die Kampagnen entwerfen und die Slogans und Bilder auswählen. Wahlwerbung richtet sich natürlich an den gleichen Menschentyp, an den sich Werbung immer richtet: Durchschnittlich, gläubig, unkritisch. Das bringt millionenfach Stimmen aus der breiten Bevölkerung. Die Stimmen der politisch Interessierten, welche die Regierungsarbeit verfolgt haben und mit ihr ins Gericht gehen könnten, fallen dagegen kaum ins Gewicht. …
Wahlpropaganda und solche Tricksereien bewirken, dass die kritische Wahlentscheidung nachdenklicher Zeitgenossen statistisch vom Strom der Ahnungslosen überlagert wird.